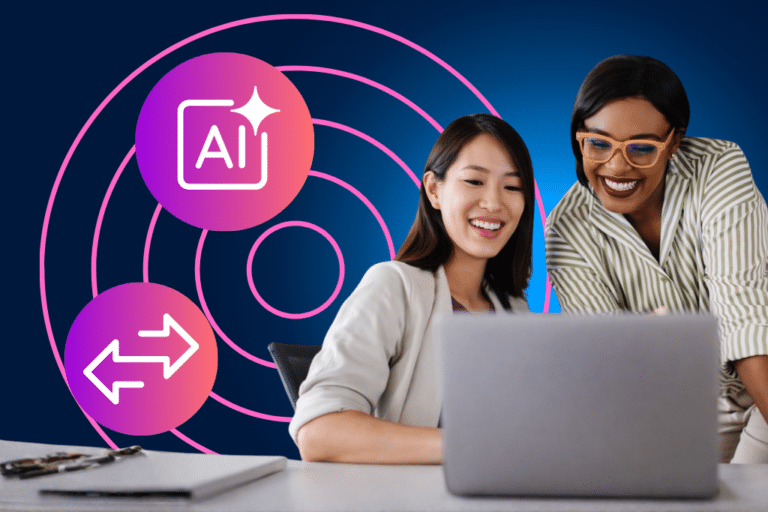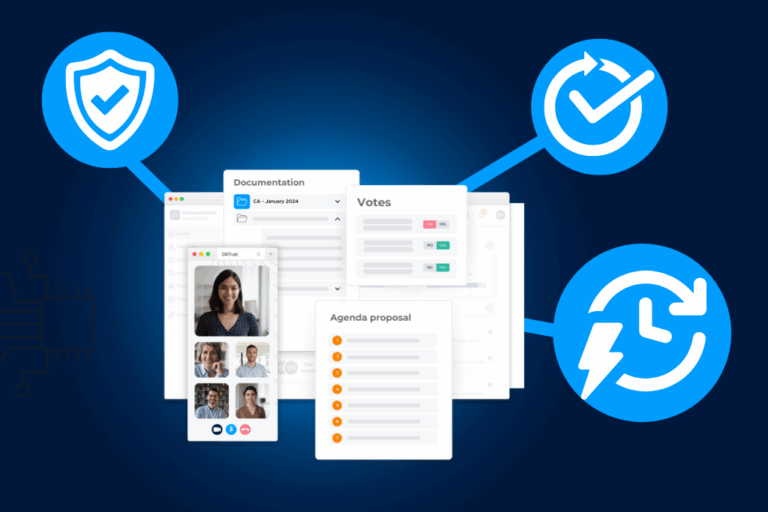Es geht nicht nur um KPIs. Und auch nicht nur ums Sparen. So überraschend es klingen mag: Der wahre Schlüssel zum Legal ROI liegt in der digitalen Reife.
Auch wenn der Begriff „digitale Bereitschaft“ häufig in technischen Begriffen verwendet wird, spiegelt er doch die Fähigkeit einer Organisation wider, sich an ein digitales Umfeld anzupassen. Die juristische Welt ist bekanntlich eine der widerstandsfähigsten gegenüber Veränderungen, was vielleicht an der Natur der juristischen Berufe und dem menschlichen Aspekt liegt. Sie umfasst die Infrastruktur, die Kultur und die Kompetenzen, die erforderlich sind, um Technologien effektiv einzuführen und zu nutzen. In diesem Sinne geht es weniger darum, über die neuesten Tools zu verfügen, als vielmehr darauf vorbereitet zu sein, sich kontinuierlich und ohne Unterbrechung weiterzuentwickeln.
Fakten: Laut einer McKinsey-Studie aus dem Jahr 2023 sind Unternehmen mit einem höheren digitalen Reifegrad um 23 % profitabler als ihre weniger digital ausgereiften Konkurrenten.
Vielleicht klingt der einfache Gedanke an einen „Legal ROI“ für andere Abteilungen seltsam. In der Tat werden sie in der Regel als Kostenstellen und nicht als Befähiger gesehen, aber das könnte heutzutage nicht falscher sein.
Digitale Bereitschaft für Rechtsabteilungen
Was bedeutet digitale Bereitschaft für Rechtsabteilungen? Zunächst einmal könnte man sagen, es bedeutet, dass man in der Lage ist, mit den gegebenen Mitteln einen Mehrwert zu schaffen. Das können Werkzeuge sein, ja, aber es geht noch weiter. Für Rechtsabteilungen bedeutet digitale Bereitschaft die Fähigkeit, in einem komplexen, regulierten Umfeld strategische, effiziente und vorschriftsmäßige Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Dazu gehört mehr als der effiziente Einsatz von rechtlichen Technologieplattformen, denn echte Bereitschaft kommt mit:
Wenn diese Elemente vorhanden sind, können die Rechtsabteilungen die Instrumente besser übernehmen und sich an ihr Umfeld anpassen. Infolgedessen können sie sogar ihren Beitrag zu den strategischen Zielen direkter darstellen. Wenn die Mitglieder eines Rechtsabteilungen zum Beispiel mit den über ihre Tools verfügbaren Daten vertraut sind, können sie ihren Beitrag für ein größeres internes Publikum besser zum Ausdruck bringen.
Tools vs. Bereitschaft
Teams, denen es an digitaler Vorbereitung mangelt, tun sich oft schwer mit der Einführung neuer Technologien. In den meisten Fällen liegt es nicht an den LegalTech-Tools selbst oder an der potenziell erzielbaren Rendite. Woran liegt es dann? Es ist der Kontext, in dem sie eingeführt werden. So kann beispielsweise eine hochentwickelte Vertragsverwaltungsplattform in einer Umgebung, in der die Arbeitsabläufe weiterhin manuell sind, Datensilos bestehen und die Teams nicht bereit sind, ihre Gewohnheiten zu ändern, unterdurchschnittliche Leistungen erbringen.
Widerstand rührt oft aus einer Mischung von Unsicherheit und Angst… Aus dieser Angst heraus befürchten die Endbenutzer, dass die Automatisierung ihre Rolle beschneidet. Ohne ein gemeinsames Verständnis für das „Warum“ neuer Systeme und ohne strukturiertes Änderungsmanagement kann selbst die vielversprechendste Lösung zu einem Streitpunkt werden.
Digitale Bereitschaft ist also ebenso eine Frage der Einstellung und der Führung wie eine Frage der Infrastruktur. Es geht darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Mitarbeiter Tools als Verbündete sehen, die ihr Fachwissen ergänzen, und nicht als Ersatz oder Bedrohung. Infolgedessen ist ihre Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, größer.
Wege zur digitalen Bereitschaft
Die Förderung der digitalen Bereitschaft in Rechtsabteilungen beginnt mit Engagement. Die Führungskräfte müssen den Bedenken aufmerksam zuhören und eine Vision formulieren, die die digitale Transformation als Chance zur Stärkung der Handlungskompetenz sieht.
Dies bedeutet, dass angemessene Schulungen angeboten, klare Erfolgskriterien definiert und Raum für Feedback geschaffen werden müssen. Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Transformation nicht geradlinig verläuft. Die Erprobung neuer Tools mit Vorreitern, die Überprüfung bestehender Arbeitsabläufe und die Abstimmung der rechtlichen Ziele mit der allgemeinen Unternehmensstrategie sind Teil eines nachhaltigen Ansatzes.
Es ist wichtig, die Angst direkt anzusprechen. Haben die Menschen Angst, ersetzt zu werden? Fühlen sie sich von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen? Oder sind sie einfach mit dem Tempo der Veränderungen überfordert? Diesen Fragen sollte nicht ausgewichen werden. Je offener sie angesprochen werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Abteilung echte Bereitschaft entwickelt.
Wie man den digitalen Reifegrad in Rechtsabteilungen misst
Bewertungen des digitalen Reifegrads bieten eine strukturierte Möglichkeit, die aktuellen Fähigkeiten zu bewerten und Prioritäten zu setzen. Laut Deloitte’s 2023 Legal Operations Survey betrachten sich nur 19 % der Rechtsabteilungen von Unternehmen als „digital fortgeschritten“. Die meisten befinden sich noch in einem frühen oder mittleren Stadium und haben Schwierigkeiten, Systeme zu vereinheitlichen oder Daten effektiv zu nutzen.
Zu den wichtigsten zu bewertenden Dimensionen gehören:
- Standardisierung von Prozessen: Sind die Arbeitsabläufe dokumentiert und teamübergreifend einheitlich?
- Nutzung der Technologie: Werden die Instrumente in vollem Umfang genutzt, oder gibt es noch Lücken?
- Datenintegration: Kann die Abteilung in Echtzeit auf relevante Daten zugreifen und diese analysieren?
- Bereitschaft zur Veränderung: Wie reagiert das Team auf neue Initiativen und Instrumente?
- Funktionsübergreifende Ausrichtung: Gibt es eine Zusammenarbeit mit der IT, der Compliance und den Geschäftsbereichen?
Eine klare Bewertung kann blinde Flecken aufdecken und Möglichkeiten aufzeigen. Im Ergebnis hilft sie den Führungskräften, einen Fahrplan zu erstellen, der die digitalen Investitionen mit der langfristigen Wertschöpfung in Einklang bringt und letztlich einen legalen ROI erzielt.
Legal ROI ist mit der richtigen Einstellung möglich
Digitale Bereitschaft ist kein Projekt, das abgeschlossen werden muss, sondern eine Fähigkeit, die gefördert werden muss. Für Rechtsabteilungen ist dies der Unterschied zwischen der bloßen Einführung von Tools und der vollständigen Umstellung der Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Wenn die Bereitschaft als kulturelles und strategisches Gut betrachtet wird, ist der ROI ein natürliches Ergebnis.
Die Messung des Reifegrads, die Einbindung der Teams und die klare und zielgerichtete Nutzung der Technologie sind die Schritte, die es den Rechtsabteilungen ermöglichen, sich selbstbewusst in eine digitale Zukunft zu bewegen.