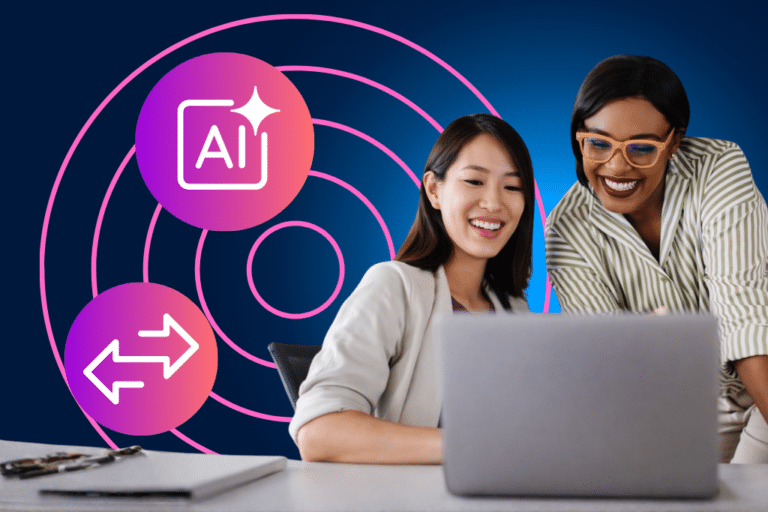Der Klimawandel und die regulatorischen Veränderungen, die diese globale Herausforderung ausgelöst hat, sind nichts Neues. Der Green Deal der EU und CSRD (Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen) stehen im Mittelpunkt dieser Veränderungen. Unabhängig von der Branche oder dem Sektor sind die meisten Unternehmen heute verpflichtet, bestimmte ESG-Vorschriften einzuhalten und über ihre Fortschritte zu berichten. Einige Branchen haben diese Auswirkungen jedoch stärker zu spüren bekommen als andere. Im Jahr 2025 stehen insbesondere der Europäische Green Deal und die CSRD im Zentrum des Wandels. Diese Entwicklungen prägen die regulatorischen Rahmenbedingungen maßgeblich. Rechtsexperten müssen sich in diesem komplexen Umfeld zurechtfinden. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Sie sollen auch dazu beitragen, ihre Unternehmen strategisch für nachhaltiges Wachstum aufzustellen.
Was bedeutet das für die Rechtsabteilungen im Energiesektor? Lassen Sie uns das regulatorische Umfeld erkunden und herausfinden, wie Rechtsabteilungen diese sich entwickelnden Anforderungen erfolgreich bewältigen können.
Verstehen der regulatorischen Landschaft
Bevor wir uns mit den direkten Auswirkungen auf die Arbeit von Rechtsabteilungen und deren praktische Handhabung befassen, sollten wir zunächst die Ziele der EU-Initiativen Green Deal und CSRD betrachten. Vor allem ist es wichtig, ihre spezifische Rolle im Energiesektor zu verstehen.
Die Auswirkungen des EU Green Deal auf den Energiesektor
Kurz gesagt: Der Europäische Green Deal ist der Fahrplan der EU zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050. Das ist ein kühnes Ziel, und um es zu erreichen, gibt es eine Reihe von Gesetzespaketen, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und nachhaltige Energiepraktiken zu fördern. Einige der wichtigsten Komponenten sind das Fit-for-55-Paket und die Energieeffizienzrichtlinie.
Fit für 55 Paket
Das Fit-for-55-Paket umfasst alle Zielvorgaben des Green Deal der EU. Insgesamt sollen die Emissionen bis 2030 um 55 % im Vergleich zu den Werten von 1990 gesenkt werden. Eine der jüngsten Aktualisierungen dieser Rechtsvorschriften legt den Schwerpunkt auf die Verringerung der Methanemissionen. Dieses Gas, dessen Lebensdauer in der Atmosphäre 12 Jahre beträgt, entsteht bei der Förderung von Öl und fossilem Gas. Mit der Änderung sollten bestimmte Lücken geschlossen und „die Förderung von Erdöl und fossilem Gas, aber auch die Förderung und Verarbeitung von fossilem Gas, der Transport, die Verteilung und die unterirdische Speicherung von Gas sowie Flüssiggasterminals, die mit fossilem und/oder erneuerbarem Methan betrieben werden“, ins Visier genommen werden.
Diese Art von Aktualisierungen kommen häufig vor. In dem Fit for 55-Paket finden die Rechtsabteilungen auch Überarbeitungen des Emissionshandelssystems und anderer Vorschriften, die sich auf die Energiebranche auswirken.
Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III)
Die Richtlinie über erneuerbare Energien (RED) ist der wichtigste Rechtsrahmen der Europäischen Union zur Förderung erneuerbarer Energien in allen Sektoren. Sie legt verbindliche Ziele und Regeln fest, um die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind-, Solar- und Bioenergie in der gesamten EU zu erhöhen. Die RED hat hohe Erwartungen geweckt… Ab November 2023 soll der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 mindestens 42,5 % betragen, wobei die Hoffnung besteht, dass sogar 45 % erreicht werden.
Dies bringt Herausforderungen, aber auch Chancen für den Energiesektor mit sich, da die Richtlinie Maßnahmen zur Vereinfachung von Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPA) innerhalb der Europäischen Union vorsieht. In der Tat hat die RED Verfahren eingeführt, um den Prozess zu straffen und die Nutzung von PPA zu fördern – sowohl für Erzeuger als auch für Verbraucher.
Insgesamt zielt die RED darauf ab, den Übergang der EU zu einem saubereren, nachhaltigeren Energiesystem zu unterstützen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen, indem die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringert wird.
Energieeffizienz-Richtlinie (EED)
Die Energieeffizienz-Richtlinie (EED) ergänzt diese Bemühungen, indem sie verbindliche Ziele zur Senkung des Energieverbrauchs um 11,7 % bis 2030 im Vergleich zu den Prognosen für 2020 festlegt. Sie führt Verpflichtungen sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor ein, einschließlich der Verpflichtung für öffentliche Einrichtungen, ihren Energieverbrauch jährlich um 1,9 % zu senken und jährlich mindestens 3 % ihrer Gebäude zu renovieren.
Die Richtlinie legt auch den Grundsatz „Energieeffizienz zuerst“ fest und zwingt die Unternehmen, bei allen Investitions- und Betriebsentscheidungen der Effizienz Vorrang einzuräumen. Für die Rechtsabteilungen bedeutet dies, dass sie sich mit den neuen Compliance-Anforderungen auseinandersetzen und gleichzeitig ihre Organisationen dabei unterstützen müssen, die betrieblichen Anforderungen mit den Energiesparambitionen der EU in Einklang zu bringen.
Die Rechtsabteilungen müssen diese Richtlinien interpretieren, ihre Auswirkungen bewerten und ihre Organisationen bei der Umsetzung der notwendigen Änderungen anleiten, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen.
Die CSRD und ihre Auswirkungen verstehen
Während sich der EU Green Deal auf die Bereitstellung eines strukturierten Rahmens und Bestimmungen zur Erreichung spezifischer Klimaziele konzentriert, erweitert die CSRD die Anforderungen an die Berichterstattung. Es ist erwähnenswert, dass heute etwa 50.000 Unternehmen detaillierte ESG-Angaben machen müssen. Zu diesen 50.000 zählen wir auch Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern, die in erheblichem Umfang in der EU tätig sind.
Doppelte Materialität
Die doppelte Wesentlichkeit ist ein Schlüsselelement der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsnormen und wird von vielen Unternehmen aufgrund der CSRD gefordert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die doppelte Wesentlichkeit ein Konzept ist, das finanzielle Aktivitäten mit Nachhaltigkeitszielen in Einklang bringt. Infolgedessen müssen Unternehmen nicht nur bewerten und berichten, wie sich Nachhaltigkeitsthemen auf ihre Unternehmensleistung auswirken, sondern auch, wie sich ihre Aktivitäten auf Mensch und Umwelt auswirken. Diese doppelte Perspektive erweitert die Berichterstattung weit über das finanzielle Risiko hinaus und verlangt von den Rechtsabteilungen, dass sie sich um den guten Ruf sowie um betriebliche und gesetzliche Risiken kümmern.
Europäische Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
Dieser Berichtsrahmen ist nicht völlig neu. Er führt standardisierte Berichtsrahmen ein, um Konsistenz und Vergleichbarkeit der Angaben zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Elementen gehören Umwelt-, Sozial-, Governance- und allgemeine Standards. Die doppelte Wesentlichkeit ist in der Tat Teil des ESRS. Was noch aussteht, sind branchenspezifische Standards, die für Unternehmen gelten, die in der Europäischen Union tätig (und nicht unbedingt ansässig) sind. Bislang sind bestimmte Sektoren nicht von diesen Berichtsstandards betroffen, darunter die Öl-, Gas- und Energieerzeugung. Die Energiewirtschaft muss jedoch wachsam bleiben, denn diese spezifischen Komponenten werden nicht lange auf sich warten lassen.
Versicherung durch Dritte
Die CSRD schreibt eine externe Überprüfung von Nachhaltigkeitsberichten vor und erhöht damit die Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit der veröffentlichten Informationen. Damit sollen Greenwashing und falsche Behauptungen vermieden werden. Externe Überprüfungen werden schon lange empfohlen, die CSRD macht sie zu einer gesetzlichen Verpflichtung. Die CSRD stellt keine zusätzliche Herausforderung dar, sondern bietet den Rechtsabteilungen die Möglichkeit, sich aktiv an der Reputationskontrolle des Unternehmens zu beteiligen.
Die Rechtsabteilungen sind dafür verantwortlich, dass diese Angaben korrekt und umfassend sind und den neuen Standards entsprechen, um so potenzielle Rechts- und Reputationsrisiken zu minimieren.
Herausforderungen für Rechtsabteilungen im Energiesektor
Der EU Green Deal und CSRD haben beide umfangreiche Bestimmungen, Richtlinien und strenge Normen, die Unternehmen in der Europäischen Union befolgen müssen. Für Rechtsabteilungen im Energiesektor stellen beide besondere Herausforderungen dar, die ihre tägliche Arbeit erschweren. Lassen Sie uns einige der wichtigsten Herausforderungen aufdecken.
Einhaltung erweiterter Berichtsstandards
Die Berichterstattung ist für juristische Teams nicht neu; Juristen sind an strenge Berichterstattungsrichtlinien gewöhnt und haben eine große Aufmerksamkeit für Details. Die größten Schwierigkeiten, mit denen Rechtsabteilungen bei der Einhaltung des EU Green Deal und CSRD konfrontiert werden können, sind:
- Teamübergreifende Zusammenarbeit ist erforderlich, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Dabei müssen auch die notwendigen, präzisen ESG-Daten gesammelt werden. Diese sind entscheidend, um die Anforderungen der CSRD zu erfüllen.
- Zudem ist ein erhöhter Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Das gilt besonders, da für den Energiesektor derzeit noch keine branchenspezifischen CSRD-Standards gelten. Zumindest nicht für Unternehmen, die in der EU tätig sind.
Diese Aspekte öffnen die Tür für Risiken der Nichteinhaltung. Für den Energiesektor ist es besonders hoch, da die Branche nicht nur einer der Hauptschwerpunkte der EU-Durchsetzung des Green Deal und CSRD ist, sondern auch die Grenzen zu verschwimmen scheinen: EU-Unternehmen sind betroffen, doch für Nicht-EU-Unternehmen, die in diesem Gebiet tätig sind, gelten nach wie vor andere Meldepflichten.
Rechtsexperten müssen solide Rahmenbedingungen schaffen, um eine rechtzeitige und genaue Berichterstattung zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen sie funktionsübergreifende Teams bei der Erstellung zuverlässiger Angaben anleiten, die sowohl den rechtlichen als auch den betrieblichen Erwartungen entsprechen.
Anpassung an den Clean Industrial Deal
In Anlehnung an den EU Green Deal soll der Clean Industrial Deal konkrete Maßnahmen aufzeigen , um die Dekarbonisierung zu einem Wachstumsmotor für die europäische Industrie zu machen. Er konzentriert sich insbesondere auf energieintensive Industrien (z. B. die chemische Industrie), die bei der Dekarbonisierung größere Unterstützung benötigen, sowie auf den Sektor der sauberen Technologien. Letzterer ist von besonderem Interesse, da der Clean Industrial Deal saubere Technologien als Wachstumsmotor ansieht.
Der Clean Industrial Deal der EU mobilisiert über 100 Milliarden Euro, um die Dekarbonisierung der Industrie zu unterstützen und saubere Technologien zu fördern. Rechtsabteilungen müssen sich mit den komplexen Rahmenbedingungen für staatliche Beihilfen auseinandersetzen. Sie sind dafür verantwortlich, die Förderungswürdigkeit sorgfältig zu beurteilen. Zudem müssen sie sicherstellen, dass alle damit verbundenen rechtlichen Anforderungen eingehalten werden. Das Verständnis für die Feinheiten dieser Anreize ist entscheidend für die Nutzung finanzieller Unterstützung bei gleichzeitiger Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen.
Strategische rechtliche Antworten und bewährte Praktiken
Integration von ESG in die Corporate Governance
Die Integration von ESG-Überlegungen in die Unternehmensführung ist von entscheidender Bedeutung. Dies kann in Form von internen Richtlinien geschehen, die die gesetzlichen Anforderungen widerspiegeln und mit den Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Natürlich sollte dies nicht die Geschäftsziele behindern, und hier können Rechtsexperten als strategische Berater fungieren, um beides zu bewältigen.
Interne Richtlinien allein reichen jedoch nicht aus, wenn der Rest der Organisation sie nicht beachtet. An dieser Stelle können sich auch die Rechtsabteilungen einbringen. Sie fördern das Verständnis für die Richtlinien und setzen sich aktiv für deren Durchsetzung ein. Ein zentrales Mittel dabei ist eine gut durchdachte Kommunikation mit dem Vorstand. Ziel ist es, diesen zur konsequenten Umsetzung der Richtlinien zu bewegen. Besonders wichtig ist die Aufklärung. Sie stellt sicher, dass alle Beteiligten sowohl den Inhalt als auch die Absicht der ESG-Governance verstehen.
Antizipation regulatorischer Änderungen
Wenn Unternehmen den Änderungen der Rechtsvorschriften immer einen Schritt voraus sind, können sie sich schnell anpassen und die Vorschriften einhalten. Um solche Veränderungen vorwegzunehmen, müssen Rechtsexperten die sich entwickelnde Gesetzgebung genau beobachten und diese Entwicklungen in proaktive Maßnahmen umsetzen. Dieser vorausschauende Ansatz ermöglicht es Unternehmen, nicht nur zu reagieren, sondern auch strategisch zu planen, um aufkommende ESG-Erwartungen zu erfüllen.
Um erfolgreich zu sein, müssen Rechtsabteilungen interne Nachverfolgungssysteme entwickeln, an der Szenarienplanung mitwirken und an Branchendiskussionen teilnehmen, um über kommende Gesetzgebungstrends auf dem Laufenden zu bleiben.
Einsatz von Technologie für den EU Green Deal und CSRD Compliance
Der Einsatz von Technologie ist ein entscheidender Faktor für Rechtsabteilungen, die den wachsenden ESG-Verpflichtungen effizient nachkommen wollen.
Was die Governance betrifft, so gibt es verschiedene Instrumente, die eingesetzt werden können. So helfen beispielsweise Systeme für das Vertragsmanagement (CLM) den Rechtsabteilungen, ESG-bezogene Klauseln in Lieferanten- und Kundenverträgen zu identifizieren, auszuhandeln und durchzusetzen, was das Risiko der Nichteinhaltung und das Reputationsrisiko verringert. Entity-Management-Tools zentralisieren Governance-Aufzeichnungen und Compliance-Verpflichtungen über verschiedene Rechtssysteme hinweg und schaffen so eine einzige Quelle der Wahrheit für die ESG-Ausrichtung des Unternehmens. Darüber hinaus erleichtern Verwaltungsratsplattformen eine fundierte und transparente Entscheidungsfindung. Sie bieten den Direktoren einen zeitnahen Zugang zu ESG-Leistungsdaten und rechtlichen Aktualisierungen. Diese Technologien unterstützen Rechtsabteilungen dabei, ihre Rolle neu zu definieren. Sie ermöglichen den Übergang von reinen Wächtern der Compliance hin zu strategischen Treibern der ESG-Transformation.
Vorwärtskommen
Im Jahr 2025 stehen die Rechtsabteilungen im Energiesektor an vorderster Front, wenn es darum geht, komplexe regulatorische Rahmenbedingungen wie den EU Green Deal und CSRD zu navigieren. Durch die Einbindung von Nachhaltigkeit in die Unternehmensführung, die Vorwegnahme regulatorischer Änderungen und die Nutzung von Technologien können Rechtsexperten die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und den strategischen Wandel vorantreiben.
Die proaktive Bewältigung dieser Herausforderungen versetzt Unternehmen in die Lage, nachhaltiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit in einer sich wandelnden Energielandschaft zu erreichen.